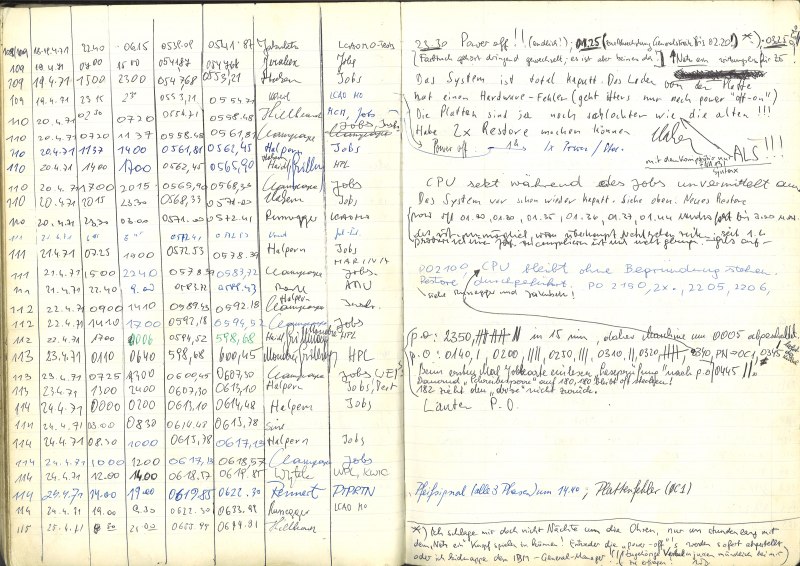Wie sich eine Universität informatisiert
Diese Skizze zeichnet – in sehr groben Zügen – die Ankunft des digitalen Rechnens an der Universität Wien nach. Die zeitgeschichtlichen Studien zur Etablierung des elektronischen Rechnens, beginnend mit der Aufstellung einer ersten programmierbaren Digitalrechenanlage Anfang der 1960er, machen vor allem einen eklatanten Mangel deutlich: das geradezu stürmische Eindringen der digitalen Rechentechnik – die auch eine Technik der Datenspeicherung und der Textverarbeitung ist – hat in gerade einmal einem halben Jahrhundert eine so fundamentale Transformation der akademischen Arbeits- und Forschungswelt mit sich gebracht, dass offenbar noch gar keine Zeit zur geschichtlichen Aufarbeitung dieser Veränderungen geblieben ist.
Die Ankunft des elektronischen Rechnens
Die Etablierung der Informatik an der Universität Wien wurzelt – zunächst vielleicht etwas überraschend – in der Statistik, die in ihrer methodischen Nähe zur ebenfalls seit jeher rechenintensiven Astronomie an der Wiege des mechanisierten Rechnens steht. Die konkrete Verbindung zwischen Statistik und Datenverarbeitung wurde an der Universität Wien durch den 1955 zum Ordinarius für Statistik berufenen Prof. Slawtscho Sagoroff hergestellt. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und Dank seiner Beziehungen zu den USA konnte Sagoroff – Ökonom, Diplomat und Weltbürger bulgarischer Abstammung – eine großzügige Stiftung der Rockefeller Foundation (US$ 80,350) erwirken, der die Anschaffung einer Burroughs 205 Datatron-Rechenanlage über einen akademischen Rabatt der Herstellerfirma ermöglichte. Die Anlage wurde allerdings erst 1962 offiziell seiner Bestimmung übergeben, nicht zuletzt, weil infolge der Errichtung des „Neuen Institutsgebäudes“ der Universität Wien in der Liebiggasse 6/Universitätsstraße 6 die Betriebsaufnahme der Anlage im Studienjahr 1960/61 noch unter recht abenteuerlichen Baustellenbedingungen erfolgen musste.
Die Rechenanlage am Statistik-Institut entwickelte rasch starke Anziehungskraft. Mit Bezug auf den Berichtszeitraum 1962/63 beispielsweise spricht Sagoroff von einer Benutzergemeinschaft, die „... gegenwärtig 25 Institute an den Universitäten Wien, Graz und Innsbruck umfaßt.“; die Rechenanlage hatte also bald den Status eines österreichischen „wissenschaftlichen Universitätsrechenzentrums“. Insbesonders theoretisch orientierte Chemiker – darunter beispielsweise Gerhard Derflinger und Günther Vinek – begannen, für ihre quantenchemischen Dissertationsprojekte die Datatron zu programmieren. Neben naturwissenschaftlichen Fragestellungen wurde aber auch mathematisch-numerischen Problemen große Aufmerksamkeit zuteil, etwa sehr früh in der Implementierung der Faktorenanalyse, wie sie für psychologische und soziologische Anwendungen relevant war. 1968 wurde die leistungsmäßig nicht mehr ausreichende und technisch inzwischen völlig veraltete Datatron-Anlage durch eine – wiederum am Institut für Statistik aufgestellte – IBM 360 Modell 44 ersetzt.
Obwohl die neue IBM 360-Rechenanlage in der technischen Auslegung ein de-dizierter number cruncher war, verfügte sie im Unterschied zur Datatron doch über ausreichend externe Speichermedien, um auch Verwaltungsdatenbestände – z.B. für die elektronisierte Inskription und nicht zuletzt die Abwicklung der neu aufgebauten österreichischen Hochschulststatistik – persistent über lange Zeit bereit zu halten. Außerdem war es nun möglich, Software in höheren Programmiersprachen (vornehmlich FORTRAN) zu implementieren und auf diese Weise erstmals eine gewisse „Maschinenunabhängigkeit“ der Anwendungsprogramme zu erreichen. Dies eröffnete den wissenschaftlichen Rechenanwendungen eine völlig neue Perspektive und erheblich erweiterte Nutzerkreise, indem nun Programme (vor allem in Form von wiederverwendbaren Unterprogrammsammlungen) verschiedener Herkunft, z.B. vom Genfer CERN, zum Einsatz gebracht werden konnten.
Medizinische Computeranwendungen
Einen zweiten Nukleus der elektronischen Datenverarbeitung an der Universität Wien bildete der an der II. Medizinischen Universitätsklinik unter Primarius Prof. Karl Fellinger 1967/68 aufgestellte Rechner IBM 360 Modell 3o, der unter Zuhilfenahme von Geldern aus der „Rundfunkspende der österreichischen Bevölkerung – Kampf dem Krebs – 1965“ finanziert wurde. An dieser EDV-Anlage entstanden die ersten Implementierungen von Datensystemen zur Erfassung und Verwaltung medizinischer Patientendaten, aus denen heraus medizinisch-statistische Forschungsfragen mit klinischen Daten versorgt werden konnten. Ein Wiener Spezifikum stellte die frühe Nutzung der Rechenanlage im Klinikbetrieb am Allgemeinen Krankenhaus Wien dar, die neben einer engen Daten-Anbindung der medizinischen Forschung an die laufende Behandlungspraxis auch eine erste Informatisierung der Ambulanzen, Stationen und Labore einleitete.
Vom Rechnerunikum zur universellen Informatikdienstleistung
Bereits unter Prof. Sagoroff gab es die Bestrebung, den Rechnerbetrieb vom Institut für Statistik in eine eigene, überfakultäre Organisationseinheit auszulagern. Dieses Interfakultäre Universitätsrechenzentrum („IRZ“) wurde auf Beschluss des Akademischen Senats schließlich im Oktober 1969 formell errichtet. Das IRZ sollte alle EDV-Belange und zentralen Rechenanlagen der Universität in sich vereinigen. Letztlich wurden im IRZ nur die IBM 360-44 des Instituts für Statistik und die inzwischen eingerichtete „Prozessrechenanlage Physik“ – bei unverändeter räumlicher Separierung – organisatorisch zusammengeführt, während das Medizinische Rechenzentrum selbständig blieb und 1973 mit der Einrichtung eines Instituts für Medizinische Computerwissenschaften eine der Entwicklung am Statistik-Institut analoge Strukturierung im Sinne einer Aufspaltung zwischen Klinik (II. Universitätsklinik für Gastroenterologie und Hepatologie) und „Rechenzentrum“ erfuhr.
Über mehrere Zwischenstufen – zeitweilig wurde das Rechenzentrum der Universität Wien über einen technischen Rechnerverbund auch mit seinem Pendant an der Technischen Universität Wien gekoppelt – entstand schließlich der heutige Zentrale Informatikdienst (ZID). Unter weitsichtiger und kompetenter Führung von Peter Rastl, ebenfalls an der Universität Wien promovierter Chemiker mit „hauseigener“ Programmiererfahrung, wirkte das Rechenzentrum maßgeblich an der Einführung des Internet an der Universität Wien (und weit darüber hinaus) ab den späten 1980ern mit und ebnete so frühzeitig einer inzwischen nicht mehr wegzudenkenden universitären Infrastruktur für Forschung, Lehre und Administration den Weg.
-

Burroughs Datatron, die erste Rechenanlage an der Universität Wien, Neues Institutsgebäude (NIG)
-

IBM 360, die zweite Rechenanlage an der Universität Wien, Neues Institutsgebäude (NIG)
-

Dr. Peter Rastl als Leiter des Zentralen Informatikdienstes (ZID) der Universität Wien
-

Computerraum (Hörsaal 27) im Hauptgebäude der Universität Wien
Last edited: 10/11/24