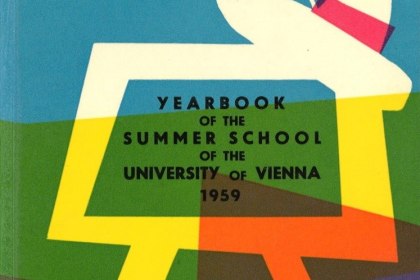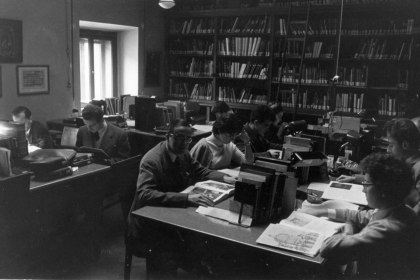Otto Benesch, ao. Univ.-Prof. Dr. phil.
österreichischer Kunsthistoriker, Vertreter der Wiener Schule der Kunstgeschichte, Direktor der Grafischen Sammlung Albertina (1947–1961)
Ehrungen
| Ehrung | Titel | Datierung | Fakultät | |
|---|---|---|---|---|
| Denkmal „Vertriebene Kunsthistoriker*innen“ | 2008/09 | Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät |
|
- Kunstgeschichte
- Philosophische Fakultät
Otto Benesch wurde 1896 in Ebenfurth, Niederösterreich, als Sohn von Heinrich Benesch (1862–1947, Südbahnbeamter, Kunstsammler) und Anna Benesch, geb. Weber (1874–?) geboren. Über seinen Vater, einen wichtigen und frühen Förderer Egon Schieles, war er früh im Kontakt mit zeitgenössischer Kunst und mit zahlreichen Künstler*innen persönlich bekannt (1913 wurde er von Egon Schiele als 17-Jähriger in einem Doppelporträt mit seinem Vater gemalt). Er absolvierte seine Schulzeit in Wien und maturierte 1915 am Bundesgymnasium Wien 13., Fichtegasse. Ab Wintersemester 1915/16 studierte er an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien Kunstgeschichte und klassische Archäologie. Sein zentraler Lehrer war dabei Max Dvořák, nach dessen Tod Beneschs Dissertation über „Rembrandts zeichnerische Entwicklung“ von dessen Kontrahenten Joseph Strzygowski 1921 eher vernichtend beurteilt, aber doch approbiert wurde. Er promovierte am 21 Dezember 1921 zum Dr.phil.
„Ich betrachte es als eine seltene Gunst des Schicksals, daß ich Max Dvorak zum Lehrer hatte und meiner Jugend so das Erlebnis eines wirklich großen Geistes und Menschen als richtungweisend auf den Weg der Wissenschaft beschert war. Durch Dvorak wurde ich dem strengen und sachlichen, allem ästhetisierenden Essayismus abholden Geist der Kunstgeschichte als einer historischen Disziplin erzogen. Das Kunstwerk als Aussage und das literarische Zeugnis als sinngemäß interpretierte Quelle sind die einzigen Grundlagen der wissenschaftlichen Betrachtung und Darstellung. Das war die Lehre, die Dvorak und Schlosser, unter dem ich wenige Monate nach Dvoraks Tod promovierte, im Anschluß an Wickhoff und Riegl vertraten.“ (Otto Benesch, Österreichische Hochschulzeitung vom 1. Februar 1959, 3)
Unmittelbar nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg diskutierten die Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns über Erhalt, Verkauf oder Aufteilung der habsburgischen Kunstsammlungen in Wien. Unter diesem Eindruck begann Benesch 1920 als Volontär in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums beim bedeutenden Rubensforscher Gustav Glück zu arbeitete. 1923 wurde er vom neuen direktor Adolf Stix eingeladen, als Assistent, später Kustos, an die Grafische Sammlung Albertina zu wechseln. Durch die Zusammenlegung bedeutender, aber bisher zertreuter Bestände des habsburgischen Kunstbesitzes befand sich diese damals im Aufbau zur zentralen Grafischen Sammlung.
„Trotz meiner wissenschaftlichen Orientierung auf den konkreten künstlerischen Tatbestand lag es mir fern, mich auf ein begrenztes eng begrenztes Spezialgebiet zu beschränken. Davor bewahrten mich meine vielseitigen Interessen, auch in anderen Disziplinen, gefördert durch den umfassenden Geist meines Lehrers ebenso wie durch den umfassenden Charakter der Sammlungen, an denen ich tätig war. Neben der Arbeit über Rembrandt und die Niederländische Kunst, fesselte mich schon seit meinen Universitätsstudien die altdeutsche Kunst, namentlich die Donauschule. […] Vieles, was ich im Umgang mit lebenden Künstlern gelernt hatte, bewährte sich als Schlüssel zur Erkenntnis auch der alten Kunst. War in der Wiener Schule bis Dvorak hauptsächlich die Entwicklungsgeschichte der Kunst gepflegt worden, so wurde mir als höchste Aufgabe unserer Wissenschaft die Erkenntnis des Kunstwerks als einer Welt in sich klar.“ (Otto Benesch, Österreichische Hochschulzeitung vom 1. Februar 1959, 3)
An der Albertina konnte nach fünf Jahren Arbeit der von ihm verfasste Katalog der niederländischen Zeichnungen des 13. und 16. Jahrhunderts erscheinen. Daneben übernahm Benesch zahlreiche weitere Katalogarbeiten sowie die Bearbeitung der Grafikbestände und zahlreicher Kataloge von Wechselausstellungen. Er publizierte u.a. auch im Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, im Staedel-Jahrbuch, im Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen, im Münchner Jahrbuch sowie im Wallraff-Richartz-Jahrbuch. Beneschs Verbindung zu Forschung und Lehre an der Universität Wien war allerdings mit dem Tod Max Dvořáks abgerissen und auch der Versuch, sich 1937 an der Technischen Hochschule Wien für Kunstgeschichte zu habilitieren, scheiterte. Seit 1934 war Otto Benesch mit der evangelisch getauften Kunsthistorikerin Dr. Eva Steiner (1905–1983), verheiratet, die auch im wissenschaftlichen Dienst der Albertina als Beamtin arbeitete. Sie war die Tochter des Industriellen Hugo Steiner und der Malerin Lilly Steiner.
Emigratio„n
Otto Benesch weigerte sich nach dem "Anschluss" 1938, sich von seiner Ehefrau zu trennen, die nach den nationalsozialistischen Rassegesetzen als Jüdin galt. Beide wurden entlassen, mussten flüchten und waren gezwungen, neue Arbeitsmöglichkeiten im Ausland zu suchen. Es folgten Aufenthalte in Frankreich bei Verwandten, später in Holland, wo er an den Universitäten von Amsterdam, Leiden, Utrecht und Groningen Gastvorträge halten konnte, ab März 1939 schließlich Großbritannien. Er konnte zwar an britischen und später auch amerikanischen Universitäten lehren und Vorträge halten, doch wurde er in England nach Kriegsausbruch als „enemy alien“ interniert. 1940 gelang es ihm auf Einladung der New York University weiter in die USA zu emigrieren, wo er 1940 in Cambridge (Massachusetts) lebte und die Möglichkeit bekam, als Vortragender und Research Fellow an zentralen Forschungseinrichtungen der USA weiter zu arbeiten: An der Harvard University (Fogg Museum of Art), setzte er an dem von Paul J. Sachs ausgebauten Forschungszentrum für Handzeichnungen seine Rembrandtarbeit fort. Auch zwei Guggenheim Fellowships (1942, 1945) und zwei Semester am Institute for Advanced Study in Princeton förderten seine Forschungen. Vor allem gelang es ihm, anders als in Wien, in den USA auch als Lehrender zu wirken und er unterrichtete an der Harvard University, der New York University und am Wellesley College. Er gab Gastvorlesungen in Yale, Fordham, Princeton, Johns Hopkins, Wesleyan, Chicago, Dumbarton Oaks, Smith-Vassar College und zahlreichen anderen akademischen Institutionen. Aus der Lehrtätigkeit entstanden wiederum zwei Buchveröffentlichungen, u.a. in Harvard „The Art of the Renaissance in Northern Europe“ (1945). Benesch unterstützte neben seiner akademischen Tätigkeit mit seinen Spezialkenntnissen auch die Organisation des amerikanischen Kunstschutzes während des Krieges, der nach 1945 grundlegend an der Aufklärung und Rückgängigmachung von Kunstraubzügen des NS-Regimes in Europa beteiligt war. Zudem schloss er sich der „Austrian Action“ (1941 von Ferdinand Czernin gegründet) an, zur Wiedererlangung „eines unabhängigen Österreich“.
Remigration | Direktor der Albertina
1947 wurde er als Direktor der Grafischen Sammlung Albertina wieder nach Wien zurückberufen, wo er u.a. auch eine repräsentative Sammlung moderner Graphik aufbaute. Er ging 1963 als Direktor in Pension. Obwohl selbst von NS-Verfolgung betroffen, hatte er als Direktor der Albertina ab 1947 die restriktive Kunstrückgabe(verweigerungs)politik der Republik dieser Jahre mitzutragen. Er war in einigen Fällen von in der NS-Zeit entzogenen Kunstsammlungen daran beteiligt, dass Ausfuhrverbote über restituierte Werke verhängt wurden, die dann - teils notgedrungen - geschenkweise oder günstig der Albertina überlassen wurden.
Im August 1946 war er habilitiert worden und im September 1948 erhielt er den Titel (aber nicht die Funktion) eines außerordentlichen Professors für Kunstgeschichte an der Universität Wien. Neben seiner Forschungs-, Ausstellungs- und Museumsarbeit an der Albertina lehrte er künftig auch an der Universität Wien.
Otto Benesch gehört neben Hans Tietze zu den bedeutendsten Nachfolgern Max Dvořáks in der sogenannten geisteswissenschaftlichen Methode der Kunstgeschichte bzw. der Wiener Schule der Kunstgeschichte. Neben seinem Hauptarbeitsfeld, der Grafik, beschäftigte er sich mit denkmalpflegerischen, kunsttheoretischen und musikwissenschaftlichen Fragen und kunsthistorisch sowohl mit der spätgotischen Kunst Österreichs und Süddeutschlands, den Zeichnungen Rembrandts und der österreichischen Moderne.
Daneben setzte er sich am Lebensende um 1963 als einer der ersten Präsidenten des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes für die aktive Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit ein.
Er starb 1964 in Wien.
Werke (Auswahl)
- Die Wiener kunsthistorische Schule, in: Österreichische Rundschau 1920
- Beschreibender Katalog der Handzeichnungen der Graphischen Sammlung Albertina, 2 Bde., 1929–33
- Rembrandt, Werk und Forschung, 1935
- Österreichische Handzeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts, 1936
- Der Maler Albrecht Altdorfer, 1939
- The Art of the Renaissance in Northern Europe, 1945
- Rembrandt, Selected Drawings, 1948
- Kleine Geschichte der Kunst in Österreich, 1950
- Die großen Primitiven, 1950
- Egon Schiele as a Draughtsman, Wien 1950 / Egon Schiele als Zeichner, 1951
- Rembrandt als Zeichner, 1963
- Meisterzeichnungen der Albertina, 1963/64
- The Drawings of Rembrandt. A Critical and Chronological Catalogue, 6 Bde., 1954–57 / Kritisches Gesamtverzeichnis der Zeichnungen Rembrandts, 6 Bd., 1964.
- Collected Writings, 4 Bde., 1970–73
- From an Art Historians Workshop, 1979
Ehrungen:
Zu Lebzeiten wurde ihm das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse verliehen. Posthum wurde 1981 nach Otto Benesch in Wien-Favoriten (10. Bezirk) der Otto-Benesch-Park benannt (seit 2021: Eva-und-Otto-Benesch-Park) und er wurde in einem Ehrengrab auf dem Hietzinger Friedhof beigesetzt. Ein Teil seines Nachlasses befindet sich im Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München.
Sein Name befindet sich auf dem 2008 enthüllten 'Denkmal für Ausgegrenzte, Emigrierte und Ermordete des Kunsthistorischen Instituts der Universität Wien' im Hof 9 des Campus der Universität Wien.
> Wien Geschichte Wiki (abgerufen 12.04.2025)
> Wikipedia (abgerufen 12.04.2025)
> Dictionary of Art Historians (Emily Crockett & Lee Sorensen) (abgerufen 12.04.2025)
> Das Rote Wien (abgerufen 12.04.2025)
> Wiener Kunstgeschichte gesichtet: Otto Benesch (abgerufen 12.04.2025)
Archiv der Universität Wien, Nationale Philosophische Fakultät 1915-1921, Philosophische Rigorosenakten PH RA 5223 (1921), Personalakt PH PA 993.
Wiener Stadt- und Landesmuseum/Historisches Meldearchiv
Zuletzt aktualisiert am 18.04.2025 - 16:34